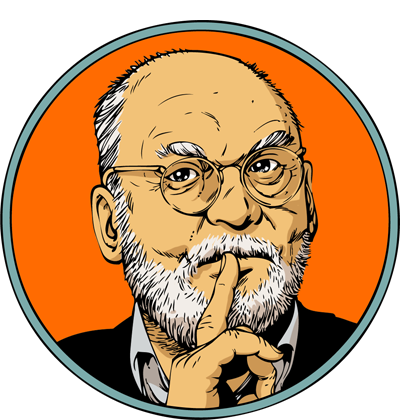© epd-bild/Peter Jülich
Zu den Hitzebetroffenen zählen nicht zuletzt Notfallsanitäter wie Julian Heilmann und Rettungssanitäterin Helene Ouellet-Roos von der der Rettungswache 11a in Frankfurt.
Das Herz des Manns rast, ihm ist schwindlig. Notfallsanitäter Julian Heilmann vom Deutschen Roten Kreuz in Frankfurt am Main (DRK) fragt ihn nach seinen Beschwerden. Ja, er habe manchmal erhöhten Blutdruck, sagt der Arbeiter. Und er habe heute nur wenig getrunken.
In Frankfurt am Main zeigt das Thermometer 33 Grad Celsius. Kollegen des Manns haben den Rettungswagen gerufen, den Heilmann kommandiert. Der Notfallsanitäter schreibt ein EKG, misst den Blutdruck, findet aber keine eindeutige Ursache für den Zustand des Mannes.
An normalen Tagen verliert der menschliche Körper etwa einen Liter Wasser über die Atmung und die Verdunstung durch die Haut. An heißen Tagen und bei körperlicher Anstrengung kann sich dieser Wert vervielfachen. Das kann viele Symptome zur Folge haben. Auch jene, die der Patient zeigt. "Kann gut sein, dass die Hitze hierbei eine Rolle spielt", sagt der Notfallsanitäter. Ein Zusammenspiel von Temperatur, Blutdruck und Flüssigkeitsmangel.
Heilmann legt dem Patienten eine Infusion an, lässt sie aber nur langsam tropfen. Wegen dessen erhöhten Blutdrucks will er den Kreislauf nicht zu stark belasten. Die Rettungsdienste treffen in diesen Tagen auf viele Menschen mit Kreislaufproblemen.
Kinder und Senior:innen besonders gefährdet
"Die Gefahr von Hitzenotfällen sollte nicht unterschätzt werden", sagt Bernd Böttiger, Bundesarzt des DRK. Besonders gefährdet sind Seniorinnen und Senioren sowie Kleinkinder. Ältere Menschen deswegen, weil sie weniger Wasserreserven im Körper haben. Und Kinder, weil die Oberfläche ihrer Körper im Verhältnis zur Körpermasse relativ groß ist und sie darüber mehr Wasser verlieren.
"Bei Hitze sollte man vor allem darauf achten, ausreichend zu trinken, mindestens einen Liter mehr als die üblichen 1,5 bis 2 Liter täglich und das nicht erst, wenn ein Durstgefühl einsetzt", rät Böttiger. Diese Strategie empfiehlt sich aber nicht für Menschen mit manchen Vorerkrankungen.
Vorerkrankte müssen auf Wasserhaushalt achten
Mehr Wasser in der Blutbahn belastet das Herz, weil es dann mehr Volumen pumpen muss. Für ein gesundes Herz ist das kein Problem, aber Herzkranke müssen auf ihren Wasserhaushalt aufpassen. Auch Nierenkranke müssen das, weil ihre Nieren nicht mehr ausreichend oder gar kein Wasser mehr als Urin ausscheiden können.
Vorerkrankte sollen sich laut Böttiger bei großer Hitze überhaupt nicht anstrengen und sich in wohltemperierten Räumen aufhalten. Die Option, sich in kühleren Räumen oder im Schatten aufzuhalten, haben manche Menschen allerdings nicht. Berufsbedingt müssen beispielsweise Beschäftigte auf dem Bau, in der Landwirtschaft oder in Straßenmeistereien auch in brühender Hitze raus ins Freie.
Hitze kann Unfälle fördern
"Die für den Menschen notwendige ausgeglichene Wärmebilanz des Körpers kann durch Arbeiten unter Hitzebelastung gefährdet werden, wodurch ein gesundheitliches Risiko entstehen kann", sagt Lea Deimel von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin in Dortmund. Als Folge könnten Einschränkungen der kognitiven und physischen Leistungsfähigkeit auftreten, was wiederum in Unfällen münden kann.
Zwar erfasst die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) in Berlin die Arbeitsunfälle in ihrer Statistik nicht differenziert nach Außentemperaturen. Die Studienlage dazu ist nach ihrer Auskunft dünn. Dennoch verpflichten Arbeitsschutzgesetz, Arbeitsstättenverordnung und Unfallverhütungsvorschrift die Arbeitgeber zu besonderen Schutzmaßnahmen für ihre Angestellten.
Für Beschäftigte, die sich berufsbedingt öfter im Freien aufhalten, müsse der Arbeitgeber eine Gefährdungsbeurteilung erstellen, erforderlichenfalls Schutzmaßnahmen ergreifen und diese dokumentieren, erklärt Deimel. Grundsätzlich, sagt sie, habe struktureller Schutz Vorrang vor persönlichen Schutzausrüstungen. Arbeitgeber müssten beispielsweise Sonnenschirme aufstellen, Unterstellmöglichkeiten für Pausen bereitstellen oder die Arbeitszeiten auf Zeiten verlegen, in denen die Sonne nicht mehr so stark scheint.
Zu den Hitzebetroffenen zählen nicht zuletzt auch Notfallsanitäter Julian Heilmann und seine Kollegin Héléne Ouellet-Ross. Nach dem vierten Einsatz des Tages sind sie vollkommen durchgeschwitzt. Vor der nächsten Fahrt gehen sie auf der Rettungswache duschen.
Hitzebedingte Notfälle
Kann der Körper Wärme nicht mehr ausreichend abführen, können verschiedene Symptome auftreten. Manche sind harmlos, manche lebensgefährlich.
Exsikkose (Austrocknung): Im Zwischenzellraum des Körpers ist nicht mehr genug Wasser. In schwereren Fällen hat das Auswirkungen auf das Gehirn. Die Betroffenen erscheinen verwirrt oder bewusstseinsgetrübt, die Körpertemperatur kann ansteigen. Die Therapie besteht im Verabreichen von Wasser. Bei Bewusstseinsstörungen muss das Wasser intravenös laufen, damit sich Patientinnen und Patienten nicht verschlucken.
Hitzesynkope: Kurzzeitige Bewusstlosigkeit infolge großer Hitze. Der Körper versucht, Wärme abzuführen, indem er die Blutgefäße in der Peripherie erweitert. Dadurch versackt viel Blut in Armen und Beinen, der Blutdruck fällt ab und es kommt zu einer kurzfristigen Unterversorgung des Gehirns, die wiederum zum Blackout führt. Eine Hitzesynkope ist in der Regel harmlos. Das Hochlegen der Beine und Kühlung des Körpers sind geeignete Gegenmaßnahmen.
Hitzschlag: Schwerer, lebensbedrohlicher Notfall, wenn die Körpertemperatur auf mehr als 40 Grad steigt. Die Hitze ist so groß, dass der Körper sie nicht mehr abführen kann. Unter diesen Bedingungen funktioniert das Gehirn nicht mehr richtig, die Betroffenen machen einen verwirrten Eindruck, haben Kopfschmerzen, Übelkeit oder werden sogar bewusstlos. Sie atmen schnell, ihr Herz rast. Gegenmaßnahmen bestehen in der Kühlung des Körpers - am besten durch lauwarmes Wasser, damit der Körper nicht durch Zittern zusätzlich Wärme produziert.
Sonnenstich: Reizung der Hirnhaut durch lange Sonneneinstrahlung auf den Kopf und Nacken. Die Symptome sind heftige Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit und unter Umständen ein steifer Nacken, in schweren Fällen auch Bewusstlosigkeit. Diese Symptome können auch erst dann auftreten, wenn die Betroffenen schon länger nicht mehr in der Sonne sind. Besonders gefährdet sind kleine Kinder und Menschen mit geringer Kopfbehaarung. Als Erste-Hilfe-Maßnahme ist das Kühlen des Kopfs mit feuchten Tüchern geeignet. Kopf erhöht lagern.